

Mimo - das Migrations-Memo
Der MIMO-Song zum Lauschen

Im Lauf des Jahres 2021 haben uns 24 Menschen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ihre Lebensgeschichten erzählt und Schuhfotos zur Verfügung gestellt. Das Memospiel zeigt eine Vielfalt von Migrationsgeschichten vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Gelegentlich haben wir den Namen oder den Wohnort unserer Gesprächspartner*innen geändert, um sie zu schützen.
In Kürze ist das Spiel hier zu bestellen.
Die Migrations-Geschichten
24 Geschichten zu 24 Schuhpaaren erzählen, wie sehr der Kreis Rendsburg Eckernförde durch Menschen von anderswo bereichert wurde und wie vielen er eine Chance auf einen Neuanfang gab. Was geht zusammen? Was gehört wozu, wer wohin? Das sind wichtige Fragen, beim Ankommen in einem neuen Land und beim Memospiel.
Manche Geschichten werden ausführlich erzählt, z.B. zwei Fluchterfahrungen am Ende des Zweiten Weltkrieges. In vielen Familien in Schleswig-Holstein können alte Menschen berichten, wie sie als Kinder aus Pommern, Schlesien, West- oder Ostpreußen fliehen mussten. Ihre Geschichten helfen dabei, sich in die Erlebnisse von Kriegsflüchtlingen heute einzufühlen. Wir möchten auch die Tatsache würdigen, dass so viele Menschen über 80 heute auf Geflüchtete zugehen und sie unterstützen.
Manche Geschichten sind sehr kurz, weil Menschen immer noch gefährdet sind – durch ihren unsicheren Aufenthaltsstatus oder durch ehemalige Landsleute, die in den Konflikten im Herkunftsland auf der gegnerischen Seite standen und heute ebenfalls Deutschland leben.
Von einem Land in ein anderes zu ziehen kann Wissensdurst stillen, Sehnsüchte erfüllen, schöpferisch machen. Es kann nötig sein, um einer großen Liebe ein Zuhause zu bauen. Auch von diesem Glück erzählen wir.
Zu manchen Geschichten können Sie Interviews hören, zu anderen Songs. Alle Songs sind geschrieben und gespielt von janeway / Carol und Dirk Bertram ©2021.

1 Horst – von Pommern nach Felde
Die Szene spielt 1942 in einem kleinen Dorf am Streitzigsee in der Nähe von Neustettin, dem heutigen Szczecinek: Der Volksschullehrer klopft an die Tür, um Familie Barz davon überzeugen, dass der zehnjährige Horst auf eine weiterführende Schule gehen solle. Der Vater wehrt ab. Ist er nicht mit Volksschulbildung Stellmachermeister geworden, genau wie sein Vater vor ihm? Wozu soll sein Ältester noch mehr Jahre auf der Schulbank absitzen? Ebenso großen Widerstand leistet Horst selbst – und geht dann doch gern auf die Mittelschule in Neustettin.
Anfang Januar 1945 erhalten die Bewohner des Dorfes den Befehl, ihre Höfe zu räumen und nach Westen zu fliehen. Wer kein Pferdegespann besitzt, kommt im tiefen Schnee nicht weit. Etwa der Hälfte der Dorfbewohner gelingt die Flucht bis nach Mecklenburg. Die anderen, unter ihnen auch Horsts Mutter mit ihren drei Söhnen, harren einen Monat lang nur 20 Kilometer von ihrem Dorf entfernt in einem Evakuierungsbereich aus, der gegen die Russen verteidigt werden soll. Dann kehren sie zurück. Die Rote Armee schließt Pommern unterdessen ein und besetzt danach Dorf um Dorf. Ein Jahr unter russischer Besatzung beginnt. Für die Frauen ist es ein Jahr voller Angst vor Vergewaltigung, viele werden zu Opfern. Polen, die ihr Land im Osten Polens verloren haben, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg Staatsgebiet der Sowjetunion wird, übernehmen Höfe und Betriebe.
Horst kennt sich in der Stellmacherei besser aus als der Pole, der den Betrieb übernimmt. Er weiß, wie die Maschinen zu bedienen sind, und bald arbeiten der polnische Stellmacher und er gut zusammen. Als Vierzehnjähriger repariert er gemeinsam mit einem Freund Traktoren, setzt die Mühle wieder in Gang, organisiert das Dreschen. Er wird schnell erwachsen.
Im April 1946 müssen alle Deutschen Pommern verlassen. Von Neustettin fahren Horsts Mutter und die drei Jungs mit dem Zug nach Stettin und am nächsten Tag mit einem Dampfer über die Ostsee nach Lübeck. In Bosau am Plöner See werden sie in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht. Der Vater schreibt ihnen aus englischer Kriegsgefangenschaft, Horst solle auf jeden Fall weiter zur Schule gehen. Alles habe die Familie verloren, aber was der Junge im Kopf habe, könne ihm niemand nehmen. Horst macht Abitur und treibt Sport.
Etwas zu leisten, sich mit anderen zu messen und sich durchzusetzen ist ihm wichtig, denn schräge Blicke und gemeine Bemerkungen der Einheimischen verletzen ihn. „Alle Vertriebenen sind Verbrecher!“ Dieser Satz, den er damals hörte, schmerzt ihn bis heute.
Er entscheidet sich für ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Kiel und wird Volksschullehrer. Es ist die schnellste Möglichkeit, mit einem Hochschulabschluss Geld zu verdienen. Während er unterrichtet und sich für die Mittelschule weiterqualifiziert, lernt er eine junge Kollegin kennen, der er gar nichts beweisen muss. Sie verliebt sich in ihn, ohne Wenn und Aber. Zwei Mal in der Woche fährt sie mit ihm in der ersten Zeit nach Bosau, um seinen Eltern beim Hausbau zu helfen. Seine schwerkranke Mutter soll noch den Einzug in ein eigenes Zuhause erleben – ein Wunsch, der sich nicht erfüllt.
Horst und seine Frau ziehen 1964 nach Felde. Sein politisches Engagement beginnt, als die Autobahn mitten durchs Dorf gebaut werden soll. Ohne ihn und seine Mitstreiter von damals gäbe es heute wohl weniger geschützte Flächen rund um Felde, das Dorf würde von einer Autobahn zerschnitten. Von 1986 bis 1994 und dann noch einmal von 1998 bis 2008 wird er Bürgermeister, obwohl er der FDP angehört. Damals sind die meisten Dörfer rund um Kiel fest in der Hand der CDU. Wieder einmal ist er aus einer scheinbar schwachen Position gestartet und hat es allen gezeigt. Er setzt sich für die Bahnstation in Felde ein, sichert der Gemeinde frühzeitig das Land, das später für die Erweiterung des Bahnhofs um ein zweites Gleis gebraucht wird, richtet einen Bauhof ein und unterstützt den Bau eines Supermarkts. „Gute Infrastruktur inmitten einer liebenswerten Landschaft“, so nennt er das. Feldes Dorfmitte sähe heute ganz anders aus, wäre er mit seinen Ideen und seinem pommerschen Sturkopf nicht gewesen.
Seine Frau hütet ohne große Begeisterung die Medaillen und Auszeichnungen bis hin zum Bundesverdienstkreuz, die ihm verliehen werden. Wichtig ist doch er selbst, nicht der Klunkerkram. Gemeinsam gehen sie durch Dick und Dünn, dann stirbt sie nur wenige Jahre nach ihrer Pensionierung. Er lebt bis heute in dem Haus, in dem seine Kinder groß wurden.
Ein Interview mit Horst gibt es hier:
Horsts Interview

2 Abieyuwa – von Benin nach Eckernförde
An ihren Sandalen klebt ganz fein noch roter Staub von ihrer letzten Reise nach Benin. Im Frühsommer 2021 konnte sie dort endlich ihren Vater beerdigen. Monatelang hatte sein Leichnam in einem Kühlhaus gelegen, weil seine Kinder wegen der Corona-Regeln nicht aus dem Ausland heimreisen konnten, um ihn so zu bestatten, wie die Tradition es verlangt. All diese Monate lang war Abieyuwa deshalb rastlos und bedrückt.
Zu ihrer Familie gehören die drei Frauen ihres Vaters und eine Schar Kinder, Enkel und Urenkel. Mit ihnen wuchs sie im Königreich Benin, einem Teil des heutigen Nigeria, auf. Abieyuwa, die in Nigeria einen Collegeabschluss gemacht hatte, kam nach Deutschland, um ihre Schwester zu besuchen, und verliebte sich hier. Seit 26 Jahren lebt sie nun schon in Deutschland, lange in Krefeld, der Heimatstadt ihres Mannes, und seit einigen Jahren im neu gebauten Einfamilienhaus in Eckernförde, nicht weit von dem Förderzentrum, das ihr jüngster Sohn lange besuchte. Heute arbeitet er in einer betreuten Werkstatt und Abieyuwa ist für ihn da, sobald er nachhause kommt. Weil er an Autismus leidet, kann er kann nicht allein bleiben.
Abieyuwa nimmt ihn und ihren älteren Sohn, der studiert, selten mit nach Nigeria, denn sie fallen dort auf und sie fürchtet wegen der wachsenden Kriminalität, sie könnten angegriffen oder entführt werden. Fast alle jungen Leute in Nigeria wollen nach Europa oder in die USA, erzählt sie, denn die Korruption verhindert, dass die Erträge aus den reichen Bodenschätzen den Menschen im Land selbst zu Gute kommen und die Wirtschaft sich entwickelt. Die jungen Menschen, die heute vom Land nach Lagos ziehen, kommen ihr schutzlos vor, weil sie den traditionellen Familienverband verlassen, in der Großstadt jedoch kein sicheres Auskommen finden. Ihr jüngerer Sohn ist bei seinem letzten Besuch in Benin aufgeblüht, fühlte sich spürbar aufgehoben im herzlichen Kontakt mit Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen und litt weniger an den Symptomen seines Autismus. Abieyuwa wünscht sich, es gäbe einen Weg, die staatlichen Angebote für behinderte Menschen, die ihr in Deutschland helfen, mit der Fürsorge einer großen, lebhaften Familie wie ihrer in Benin zu verbinden. Und sie wünscht sich, dass die klugen Köpfe ihres Landes in Nigeria Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst vorantreiben könnten statt ins Ausland zu gehen.
Zuhause bewahrt sie eine Nachbildung der berühmten Maske von Iyoba, einer Köngin Benins im frühen 16. Jahrhundert, auf. Das Original befindet sich nicht in Nigeria, sondern im Metropolitan Museum in New York. Wenn geraubte Kunstgegenstände, wie jüngst aus Frankreich, an Benin zurückgegeben werden, empfindet Abieyuwa das jedes Mal als ein Stück Gerechtigkeit und als Zeichen der Hoffnung auf ein selbstbewusstes, wirtschaftlich erstarkendes Nigeria.
Ein Interview mit Abieyuwa gibt es hier zu hören. Das Duo Janeway hat einen Song über ihren Lebensweg geschrieben.
Abieyuwas Song: I Did it on my Own
Abieyuwas Interview

3 Rascha – von Aleppo nach Eckernförde
Rascha wollte Lehrerin werden. Mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern wohnte sie in Aleppo und studierte, als im Sommer 2012 der syrische Bürgerkrieg ihre Stadt erreichte. Rascha konnte nicht mehr schlafen, nur noch selten traute sie sich, ihren Sohn in den Kindergarten zu schicken. Der Alltag in der umkämpften Stadt war lebensgefährlich, und sie wollte bei einem Bombenangriff nicht von ihrer Familie getrennt sein. Zu oft hörte sie in diesen Tagen von verwaisten Kindern und verwaisten Eltern. Als ihr Haus getroffen wurde, zog sie mit ihrer Familie zu Verwandten. Ihr Abschlusszeugnis, alle Unterlagen, Fotos und persönlichen Gegenstände waren verbrannt. Rascha und ihr Mann Mohammad entschieden sich, Syrien zu verlassen, und machten sich mit ihren Kindern auf einen monatelangen, gefährlichen Fluchtweg. Seit 2016 leben sie in Eckernförde. Raschas Kinder haben im Kindergarten und in der Schule Deutsch gelernt, ihr Mann ist Altenpfleger geworden, die alten Leute freuen sich, wenn er zur Tür hereinkommt. Rascha war lange Zeit viel zuhause und hat Deutsch in Kursen und aus Lehrbüchern gelernt, aber wenig gesprochen. Seit 2020 arbeitet sie als Schulbegleiterin, und sie strahlt, wenn sie erzählt, wie sie jeden Morgen von Kolleginnen und Kollegen, Kindern und Jugendlichen begrüßt wird: „Guten Morgen, Rascha, wie geht’s?“ Sie hat in diesem Jahr viele Kontakte geknüpft. Es ist bisher ihr schönstes Jahr in Deutschland.
Das Duo Janeway hat einen Song über Rascha geschrieben:
Raschas Song: Guten Morgen Frau Ramadan

4 Pradi – aus der Dominikanischen Republik nach Mielkendorf
Pradi freute sich, als seine große Liebe aus Norddeutschland ihm einige Tage nach seiner Ankunft einen Strandausflug versprach, doch dann war er enttäuscht. Das sollte ein Strand sein, mit so vielen Steinen? Kalt war es außerdem.
Sie hatten einander in der Dominikanischen Republik kennengelernt, wo er Touristinnen und Touristen Capoeira beibrachte und sie Kite-Surfen unterrichtete. Ihre Liebe gewann er, wie er vermutet, als er für sie Gitarre spielte. Auch sie ist Musikerin, ihr wichtigstes Instrument ist die Posaune. Bis heute gehört die Musik zu den Erfahrungen, die sie am stärksten verbinden.
Zwei Töchter haben die beiden, sie klettern auf Pradi herum, während er erzählt, wie er ihrer Mutter zuliebe nach Deutschland kam. Der große Garten des Doppelhauses, in dem sie mit Großmutter, Onkel, Tante und einem kleinen Cousin leben, ist übersät von Spielgerät. Pradi unterrichtet weiter Capoeira und macht auch in Deutschland mit den verschiedensten Menschen alle möglichen Arten von Musik. Gerade entdeckt er Heavy Metall.
Das Duo Janeway hat einen Song über Pradi geschrieben:
Pradis Song: Ride on Dreams

5 Lisa – aus Dänemark nach Altenholz
Lisa stammt aus einem 470-Menschen-Dorf in der Nähe von Ringkobing. In Dänemark ist es üblich, dass Schülerinnen und Schüler nach der zehnten Klasse ein Jahr im Ausland verbringen. Nach Deutschland? Langweilig! Das fanden Lisas Klassenkameradinnen, die nach Großbritannien, in die USA und Australien aufbrachen. Doch Lisa hielt an ihrem Plan fest und setzte damit eine Kette von glücklichen Zufällen in Gang:
Weil eine Agentur keine Gastfamilie für sie fand, empfahl eine Lehrerin ihr eine Familie in Bremerhaven. Diese Familie hatte kein freies Zimmer, wandte sich aber an Bekannte in Altenholz-Klausdorf, die Lisa gern aufnahmen. Der Sohn ihrer Gastfamilie hatte einen Freund, der kurz nach ihrer Ankunft zu einer Geburtstagsparty einlud, Lisa gleich mit. Mit dem Geburtstagskind von damals ist Lisa heute verheiratet.
Mit ihm lernte sie Kiel kennen, das ihr mit siebzehn noch aufregend und groß vorkam. Seinetwegen kehrte sie nach ihrem Abitur in Dänemark wieder nach Schleswig-Holstein zurück, um Jura zu studieren und wurde hier Rechtsanwältin. Ihm stellte sie die Fragen, die sie im ersten Studienjahr trotz ihrer guten Deutschkenntnisse verzweifeln ließen: „Was bitte“, fragte sie ihren damaligen Freund und heutigen Mann, „ist ein Rechtsgut?“
„Genau, was ist eigentlich ein Rechtsgut?“, fragt ihre Tochter, ausnahmsweise auf Deutsch, und wippt neben ihr auf dem Sofa. „Erklär’ ich dir später“, seufzt Lisa.
Mit ihrer Tochter und ihrem Sohn spricht sie Dänisch. Die Eltern ihres Mannes stammen aus der Türkei, und so gibt es Familienfeste, bei denen viel übersetzt werden muss, weil Lisas Eltern wenig Deutsch sprechen und der türkische Großvater kein Englisch.
„Oft verstehen sie sich aber doch“, sagt Lisas Tochter. „Und sonst: Hand-und- Gesicht-Sprache.“
Mutter und Tochter finden, dass Kommunikation das A und O ist, um fröhlich mit mehreren Sprachen und Kulturen zu leben.
„Und dass man etwas ausprobiert“, sagt Lisa. „Dass man beharrlich ist und nicht gleich aufgibt.“
„Und dann noch, dass man ab und zu dran denkt, dass man auch selbst mal einen Fehler macht, nicht nur die anderen“, meint Lisas Tochter.
Genau wie ihr Bruder besucht sie die dänische Schule.
Als sie klein waren, riet der Kinderarzt zu einer strikten Trennung der Sprachen. Der Vater sollte mit den Kindern Türkisch sprechen, Lisa Dänisch und die ganze Familie zusammen Deutsch. Weil Lisas Mann so selten mit den Kindern allein war, lernten sie seine Muttersprache nicht. Heute bedauert Lisa, dass sie damals nicht den Mut zu etwas mehr Sprachenmischmasch am Küchentisch hatten. Sicher hätten die Kinder dann auch gut Türkisch gelernt.
Zwei Mal im Jahr macht die Familie Ferien in der Türkei, und Lisas Tochter genießt die Sonne und die seit früher Kindheit vertraute Landschaft, vor allem aber das Willkommensein bei den Verwandten. Fast ein bisschen zu doll, wie sie da erwartet und geliebt wird, aber eben auch richtig schön.

6 Mehdi – aus dem Iran nach Vogelsang-Grünholz
Als Mehdi vor zweieinhalb Jahren in Deutschland ankam, war er glücklich, in Sicherheit zu sein, und überzeugt, bald wieder arbeiten zu können. Im Iran hatte er zehn Jahre als Buchhalter bei einer Versicherung sein Geld verdient. Um in Deutschland eine ähnliche Arbeit zu finden, wollte er schnellstmöglich die Sprache lernen und vor allem Kontakte knüpfen. Er war neugierig auf das neue Land und sicher, dass er die Sprache von den Menschen viel schneller lernen würde als aus Büchern.
Dann kam die Corona-Pandemie. Es war schwierig, dem Deutschunterricht online auf dem Handy zu folgen, und er verließ die Flüchtlingsunterkunft noch seltener als zuvor. Immer öfter drehen seine Gedanken sich im Kreis: Er ist doch kein junger Mann mehr. Wie soll er es schaffen, die Sprache zu lernen und an seinen alten Beruf anzuknüpfen, wenn er kaum einmal mit Deutschen spricht?
Schon vier Monate nach seiner Ankunft bekam er einen sicheren Aufenthaltstitel und machte sich auf die Suche nach einer Wohnung in Kiel oder Flensburg, denn er hat im Iran in einer Großstadt gelebt und fühlt sich als Städter. Bis heute ist seine Suche erfolglos, und immer häufiger fühlt er sich an der Ostseeküste wie ein Gestrandeter. Wenn er einsam ist, vermisst er seine beiden Hunde, die er im Iran zurücklassen musste.
In Vogelsang-Grünholz hat er eine eigene Wohnung gefunden. Darüber, wie oft er trotzdem in der Flüchtlingsunterkunft zu Besuch ist, weil ihm die Gemeinschaft gut tut, muss er lächeln.
Er braucht einen zweiten Neuanfang in Deutschland, Stadtluft statt Meeresbrise, Arbeit statt Schulbücher, und hofft auf das Ende der Pandemie.

7 Maya – aus Darfur über Ägypten nach Rendsburg
Die Kämpfe zwischen der Rebellenbewegung in Darfur und den mit der Regierung verbündeten arabischen Milizen prägten jahrelang Mayas Leben, brachten Überfälle, Hunger, Chaos und ständige Angst. 2013 entschloss sie sich, mit ihren drei Kindern nach Ägypten zu fliehen. Dort arbeitete sie als Hausangestellte, um ihnen ein Dach über dem Kopf und Essen zu sichern. Als Flüchtling war sie rechtlos und ihren Arbeitgebern vollkommen ausgeliefert. Sie wischt sich durchs Gesicht, um zu zeigen, dass sie wegen ihrer Hautfarbe verachtet wurde. Alles, was man sich an Gewalt vorstellen könne, habe sie erlebt, sagt sie.
Seit kurzem ist sie mit ihren beiden Töchtern in Deutschland. Ihr Sohn durfte nicht mitkommen, weil er gerade volljährig geworden war und nur Frauen mit minderjährigen Kindern aufgenommen wurden. Die Sorge um ihn lässt ihr keine Ruhe.
Ihre Töchter gehen zur Schule und zu dritt haben sie Radfahren gelernt. Wenn Maya in die Pedale tritt und ihre jüngere Tochter auf dem Gepäckträger sitzt und mit den Beinen schlenkert, während die ältere nebenher japst, dann kommen sie vor Lachen außer Atem. Ihre Töchter können hier sogar nach Einbruch der Dunkelheit von der Bushaltestelle nachhause gehen, ganz ohne Gefahr. Sie werden in einem sicheren Land einen Beruf erlernen, vielleicht sogar studieren. Das hat Maya geschafft

8 Barbara – aus Schlesien nach Bordesholm nach Namibia und wieder nach Bordesholm
Ein tiefes eigenes Fremdheitsgefühl macht Barbara hellhörig für die Erfahrungen geflüchteter Menschen.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges floh sie mit ihrer Mutter und zwei jüngeren Schwestern aus dem schlesischen Erholungsort Oberschreiberhau nach Westen. Der Ort liegt im Riesengebirge, unterhalb der Schneekoppe, in der Nähe der Elbquelle. Heute heißt er Szklarska Poreba und gehört zu Polen. Wenn Barbara später unglücklich war, träumte sie sich hierher zurück, auf die Waldwiesen und zum Blaubeerpflücken.
Fünf Jahre war sie alt, als ihre Flucht in den Westen Deutschlands begann. Manche Eindrücke von unterwegs sind ihr lebhaft im Gedächtnis geblieben, volle Eisenbahnwagons, die mit Rucksack und Koffern bepackte Mutter, die Sorge um die beiden jüngeren Schwestern, auf die Barbara im Gedränge achtgeben sollte, die wunderbar warme Suppe vom Roten Kreuz am Schlesischen Bahnhof in Berlin, wo die Familie einen Tag und eine Nacht verbrachte.
Die erste Zwischenstation ihrer Flucht war Premnitz bei Rathenow. Weil sich im Ort eine Fabrik für Panzer befand, wurde er von der britischen Luftwaffe bombardiert. Es war wichtig, Schuhe, Jacke und Rucksack neben dem Bett zu haben, um bei nächtlichem Bombenalarm sofort losrennen zu können. Vier Monate von Januar bis April 1945 verbrachte die Familie hier und reiste dann weiter zu einer Verwandten in Hamburg, die für sie ein Quartier in einem Pastorat in der Nähe von Stade organisierte. Die Zeit im Pastorat war paradiesisch, erinnert sich Barbara, weil sie hier ein Kaninchen als Haustier geschenkt bekam und weil die Kinder im Obstgarten Fallobst sammeln durften. Die vielen Äpfel bedeuteten Fülle, Überfluss und pures Glück. Himmel-und-Erde aus Äpfeln und Kartoffeln wurde Barbaras Lieblingsgericht. Wenn sie Kinder aus dem Dorf traf, merkte sie, dass sie anders sprach als die Einheimischen, und fühlte sich zum ersten Mal fremd.
Dieses Gefühl vertiefte sich in Cuxhaven, wo die Familie 1946 eineinhalb Zimmer bezog. Hierher kehrte ihr Vater aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück, hier wurde Barbaras jüngste Schwester geboren, hier wurde sie selbst 1947 eingeschult. Ihr Vater, ein Zahnarzt, konnte bald nach seiner Rückkehr wieder arbeiten. Ihm kam zugute, dass er in den USA die neuesten Methoden, Techniken und Instrumente der Zahnmedizin kennengelernt hatte. Schon 1947 bekam die Familie eine Wohnung. Barbaras Mutter wurde nicht warm in der neuen Stadt, und ihr Fremdheitsgefühl, so glaubt Barbara heute, übertrug sich auf sie selbst als älteste Tochter. In ihre Schulklasse gingen die Kinder der Cuxhavener Industriellen, doch Barbara wusste nicht einmal wer Frauke Mützefeldt, Spross der Eigner von Cuxhavens größter Werft, war. Niemand half ihr, sich zurechtzufinden. Das Gefühl, fremd zu sein, setzte sich fest. Als Barbara Deutsch studierte, Lehrerin wurde und in Schleswig-Holstein eine Familie gründete, war es keine Quelle von Schmerz mehr, sondern eine einfache Tatsache.
Es schärfte ihr Gespür dafür, wie es den Flüchtlingen gehen mochte, die Ende der achtziger Jahre aus Zaire, Togo, Kamerun und Nigeria nach Bordesholm kamen. Sie übersetzte für sie, sprach in der Gemeinde der Christuskirche über deren Situation, fand Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die Gruppe sammelte Fernseher und Kühlschränke, die in den Unterkünften fehlten, und organisierte Sprachkurse. Vor allem aber besuchten sie die Menschen, schenkten ihnen Aufmerksamkeit und Zeit.
Barbara erklärte deutsche Gesetze und Bildungsmöglichkeiten, sie zeigte den Neuankömmlingen Wege auf, die sie dann selbst gehen mussten. Wenn Pläne scheiterten, war sie da und ermutigte zu einem zweiten oder dritten Anlauf. Heute rät sie Unterstützerinnen und Unterstützern, sich mehr abzugrenzen, als sie es damals tat. Die Arbeit habe sie ausgelaugt, ja aufgefressen. Die Entwurzelung vieler Flüchtlinge erschreckte sie und nährte in ihr den Wunsch, etwas zu tun, damit Menschen gar nicht erst fliehen müssen. Gern hätte sie in einem der ostafrikanischen Länder gearbeitet, aus denen sie so viele Menschen kennengelernt hatte, doch weil dort die politische Lage zu instabil war, ging sie nach Namibia, um Lehrerinnen und Lehrer fortzubilden. Von Anfang an ignorierte sie den Ratschlag, zum Schutz vor Skorpionen Stiefel zu tragen. Sie lief in Sandalen durch die Stadt, durch die Savanne, durch das Lehrerfortbildungsinstitut und durch die Dörfer, in denen sie ihre Kolleginnen und Kollegen besuchte. Im Wüstenland Namibia sammelt sich in geschlossenen Schuhen rasch Sand, in Sandalen sickert er herein, aber er rieselt auch wieder hinaus, erklärt Barbara. Sie habe etwa ein halbes Jahr gebraucht, um sich an die Wertvorstellungen in Namibia zu gewöhnen, wie wichtig zum Beispiel Freundlichkeit sei und wie absolut unwichtig Pünktlichkeit. Doch von Anfang an habe sie sich willkommen und herzlich aufgenommen gefühlt. Es sei das Gegenteil zu den Erfahrungen ihrer Jugend gewesen.
Ein Interview mit Barbara und einen Song über sie gibt es hier:
Barbaras Song: Feeling at Home
Barbaras Interview

Ariana – aus Albanien in den Kreis Rensburg-Eckernförde
Ariana kam Anfang der 90er Jahre als politisch Verfolgte nach Deutschland. Von den Gründen der Verfolgung zu sprechen würde sie auch heute noch gefährden.
Für die Reise nach Deutschland zog sie damals Stiefel an. Sie waren handgenäht und haltbar, hatten in Albanien einen Monatslohn gekostet und waren ihr am Anfang zu groß gewesen. Nicht nur für Kinder kaufte man in Albanien Schuhe zwei Nummern zu groß und stopfte sie erst einmal mit Wolle und Zeitungen aus, sondern auch für Erwachsene, damit der Schuster später Material zum Reparieren abnehmen konnte, falls Nähte aufgingen oder die Schuhe Löcher bekamen. Ariana war als Mädchen fasziniert vom Schusterhandwerk, sie saß in der Werkstatt und schaute zu, bis sie jeden Handgriff kannte.
Der Sommer 1991, ihr erster in Deutschland, war ungewöhnlich heiß. Sie erwartete nicht, dass er einmal enden würde, denn deutschen Herbstregen konnte sie sich noch gar nicht vorstellen. Als sie sich in der Kleiderkammer des Roten Kreuzes ein paar Schuhe aussuchen durfte, wählte sie rosafarbene Ballerinas. In diesen Ballerinas lief sie täglich vier Kilometer von ihrer Unterkunft zur nächstgelegenen Stadt und wieder zurück, in ihnen lief sie zum Einkaufen und zum Deutschunterricht. Die Ballerinas erwiesen sich als außerordentlich haltbar.
Sie lernte zwei junge Frauen kennen, die für eine christliche Sondergemeinschaft missionierten. Eine kam sie in ihrer Unterkunft besuchen. Ariana und ihr Cousin freuten sich so sehr darüber, dass sie der Besucherin ein Geschenk kaufen wollten. Am nächsten Tag liefen sie zum Buchladen in die Stadt. Als sie berieten, welchen Kalender sie kaufen sollten, sprach eine Mitarbeiterin der Buchhandlung sie an. Was das denn für eine Sprache sei? Albanisch? In Albanien sei sie gewesen. In diesem Augenblick, so erinnert sich Ariana, füllte Albanien den ganzen Buchladen.
In den achtziger Jahren reisten deutsche Touristengruppen nach Albanien, weil es ihrer Überzeugung nach als einziges Land auf der Welt den Kommunismus verwirklichte. Viele von ihnen lebten in der nächstgelegenen Stadt, sie kannten Albanien und konnten sogar auf Albanisch „Guten Morgen“ sagen. Einige lernte Ariana nun kennen.
In Albanien hatte sie häufig erlebt, wie neugierige Deutsche durch Dörfer und Betriebe geführt wurden. Mit ihnen zu sprechen war verboten, doch die albanischen Schneiderinnen sahen sich die Reisenden genauestens an und eilten nachhause, um die Schnitte ihrer Kleidung frisch aus dem Gedächtnis zu skizzieren. Ariana ging gern an den Fremden vorbei, weil sie gut rochen. In Deutschland suchte sie lange erfolglos nach diesem Geruch. Erst Jahre nach ihrer Ankunft, als die rosafarbenen Ballerinas längst durchgelaufen waren, sie einen deutschen Pass besaß und Höhen und Tiefen eines Lebens in Deutschland hinter ihr lagen, fand sie den Geruch in einer Parfümerie und schickte ein Fläschchen davon an ihre Schwester, die in einem anderen Exilland lebt.

Mohammed – aus Libyen nach Vogelsang-Grünholz
Mohammed wurde in der Diktatur Muammar al-Gaddafis geboren. Seine Jugend war von Bürgerkriegen und den Kämpfen rivalisierender Milizen geprägt. In Libyen sah er keine Chance, etwas zu lernen. Sogar das Überleben war ungewiss. Nach all dem Grausamen, das er als Kind und Jugendlicher erlebte, erscheint ihm eine Zukunft in Deutschland als riesige zweite Chance. Um hier wirklich anzukommen und gut Deutsch zu lernen, wünscht er sich Kontakt zu Einheimischen, doch in Vogelsang-Grünholz gibt es nur wenige Freizeitangebote für junge Leute wie ihn. Er geht vormittags zur Schule, kocht gern und kümmert sich um Neuankömmlinge in der Flüchtlingsunterkunft, einem alten Hotel. Es fällt ihm leicht, auf Menschen zuzugehen, seine Freundlichkeit baut Brücken.
Ein Freund, der ebenfalls aus Libyen kommt und in der Nähe von Eckernförde wohnt, hat deutsche Bekannte und nimmt ihn manchmal mit zu Treffen. Dann öffnet sich für Mohammed ein Fenster zum Alltag, den Gewohnheit, den Gedanken der Menschen hier – ein bisschen Nahrung für seine große Neugier.

Theis
Gelegentlich sagt jemand zu Theis, er sei ja ein halber Däne oder ein halber Deutscher. Dann widerspricht er. Ein ganzer Däne und auch ein ganzer Deutscher ist er, weil er sich in beiden Kulturen hundertprozentig wohl fühlt.
Schon die allerersten Tage seines Lebens fanden teils in Dänemark, teils in Deutschland statt. Seine Eltern waren nach dem Studium in Dänemark nach Husum gezogen, um dort zu arbeiten. Kurz vor seiner Geburt fuhren sie über die Grenze nach Sonderborg ins Krankenhaus. Er sollte in Dänemark zur Welt kommen, weil seine Mutter sich in der deutschen Sprache noch nicht ganz sicher fühlte. Als Säugling ging’s zurück nach Husum, und seitdem ist er in beiden Ländern zuhause.
Seine beiden Geschwister und er besuchten die dänische Schule in Husum und wuchsen ganz selbstverständlich zweisprachig auf. Nach der neunten Klasse ging er zwei Jahre lang auf ein deutsches Internat. In dieser Zeit begann er, auf Deutsch zu träumen und auf Deutsch zu schimpfen, wenn ihn etwas ärgerte. Dann zog er ins dänische Apenrade und machte dort ein international anerkanntes Abitur. Auf Reisen merkte er, wie gern er mit Kindern arbeitet. Er kehrte nach Kiel zurück, studierte und fand seine erste Stelle als Lehrer an der dänischen Schule in Dänischenhagen, die er heute leitet.
Nach Unterschieden zwischen den beiden Kulturen befragt, fallen Theis die viel flacheren Hierarchien in Dänemark ein. An seiner Schule sind alle Kolleginnen und Kollegen per Du, alle empfinden sich als gleich wichtig für das große Ganze, und der Hausmeister und er ziehen einander ständig mit Scherzen auf. An einer deutschen Schule ginge es sicher förmlicher zu.
Auch die Nähe zu den Eltern ist an der dänischen Schule größer. Sie werden zu Festen oder zum Grillen eingeladen und sind immer auf einen Kaffee willkommen. Nur wenn man sich kennenlernt, können Freundschaften entstehen, meint Theis, und wenn die Erwachsenen einander vertrauen, lassen sich die Probleme der Kinder viel leichter lösen. Sie erleben ihre Schule dann als Teil einer Gemeinschaft und diese Geborgenheit hilft beim Lernen.
Die Schule wird von Kindern der dänischen Minderheit besucht, doch auch Kinder aus deutschsprachigen Familien sind willkommen, wenn sie zuvor im dänischen Kindergarten waren und ihre Eltern bereit sind, Dänisch zu lernen. Dabei kommt es nicht auf Perfektion an. Das Dänische ist im weltweiten Vergleich eine der Sprachen mit dem höchsten Grad an Willkürlichkeit zwischen Aussprache und Schrift. Das heißt, dass man als Ausländerin oder Ausländer fast nie weiß, wie ein Wort gesprochen wird, wenn man es liest, oder wie es geschrieben wird, wenn man es hört. Niemals würden Theis und seine Kolleginnen und Kollegen lachen, wenn sich die Sprechversuche von Eltern etwas ungewöhnlich anhören. Sie sind froh über jedes dänische Wort, das die Eltern ausprobieren.
Theis sieht große Unterschiede zur Arbeit seiner Frau an einer Kieler Stadtteilschule mit Kindern aus der ganzen Welt. Hier wechseln die Kinder ständig aus der Schulkultur in eine völlig andere Familienkultur und wieder zurück. Neben all den schweren Erlebnissen, die sie mitbringen, ist das eine große Aufgabe, findet Theis.
Sein eigenes Leben in zwei Kulturen ist da viel unbeschwerter. Im Lauf seines Lebens hat es ihm sogar immer mehr Spaß gemacht, die Dinge aus wechselnden Perspektiven zu betrachten, mal als ganzer Däne und mal als ganzer Deutscher.
Ein Interview mit Theis ist hier zu hören:
Theis Interview

Ferry – aus Teheran nach Melsdorf
Ferry Morid hatte viele Berufe. Er kam Ende der siebziger Jahre nach Kiel, um Ingenieurwissenschaften zu studieren. Im nächsten Jahr schon, so versicherten sich die iranischen Studentinnen und Studenten gegenseitig, werde das Regime des Ayatollah Khomeini zusammenbrechen und dann würden sie in den Iran zurückkehren. Doch das Regime hatte Bestand und Ferry Morid verlängerte seinen Aufenthalt in Deutschland ein ums andere Jahr. Er heiratete eine iranische Kommilitonin, die in Kiel Pharmazie studierte und eine Apotheke eröffnete. Er selbst machte aus seinem Studentenjob einen Beruf, eröffnete zuerst ein Restaurant, dann noch eins und bald so viele in verschiedenen Städten Schleswig-Holsteins, dass er früh aufstehen musste, um im Laufe eines Tages überall nach dem Rechten zu sehen, und spät ins Bett fiel. Seine beiden Töchter sah er selten. Als er beschloss, kürzer zu treten und die Restaurants zu verkaufen, wuchs ihm ein zweiter Beruf zu. Er übersetzte für geflüchtete Menschen, die neu nach Deutschland kamen, wurde immer häufiger angefragt und vom Oberlandesgericht Schleswig als Dolmetscher und Übersetzer vereidigt. Seit 2015 hat er vielen geholfen, im Kreis Rendsburg-Eckernförde Fuß zu fassen. Er ist ein geselliger Mensch und spielt auch jetzt noch, mit nachlassenden Stürmerqualitäten, aber gewachsenem taktischen Geschick, in einer Fußballmannschaft. Traurig stellt er fest, dass er heute in Deutschland mehr als Ausländer betrachtet und angesprochen wird als vor dreißig Jahren. Trotzdem sei sein Leben schön gewesen, reich an Arbeit und an Erlebnissen. Nur das Leid der vielen Menschen, die er als Übersetzer kennenlernte, laste auf ihm.
Ein Interview mit Ferry und einen Song über ihn von Janeway gibt es hier:
Ferrys Song: Belong
Ferrys Interview

Zahar – aus dem Iran nach Vogelsang-Grünholz
Mit ihrem Mann Sajad hat Zahar in Maschhad gelebt, einer Stadt mit über drei Millionen Einwohnern im Nordosten Irans. Maschhad ist seit seiner Gründung im Jahr 823 ein politisches und religiöses Zentrum. 20 Millionen Pilger und Touristen besuchen die Stadt jedes Jahr, u.a. weil sich hier das Grabmal des achten schiitischen Imams Reza befindet. Der persische Herrscher Nadir Schah, der von 1736 bis 1747 regierte, machte Maschhad zu seiner Hauptstadt. Zahar war es gewohnt, sich durch Straßen voller Menschen zu kämpfen, in einem Gewimmel aus Tradition und Moderne, vorbei an Hochhäusern und den riesigen goldenen Kuppeln des Imam-Reza-Schreins. Als sie in Vogelsang-Grünholz ankam, musste sie erst einmal weinen. Wie sollte sie sich eine Zukunft auf dem Dorf aufbauen? Wie hier neue Freundschaften schließen, Arbeit finden?
Ihr helfen der Zusammenhalt unter den Geflüchteten im Dorf und die gute Beziehung zu ihrem Mann Sajad. Sie sind entfernt verwandt, stammen aus derselben afghanisch-stämmigen Familie und haben schon als Kinder miteinander Fußball gespielt. Auch als Ehepaar gehen sie spielerisch und kameradschaftlich miteinander um. Das gemeinsame Lachen verbindet sie.

Tarek – aus Syrien nach Kronshagen
Tarek gehörte in Syrien einem Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten an, die eine Alternative zu den gleichgeschalteten Medien in der Diktatur Baschar al-Assads bieten wollten. Sehr jung, noch in seinem letzten Schuljahr, begann er, über Demonstrationen, Kämpfe und Übergriffe von bewaffneten Einheiten auf Zivilisten zu berichten. Als er ein Gefecht zwischen Regierungstruppen und Aufständischen dokumentierte, traf ihn ein Schuss in die Schulter – das ist der Grund, warum er, der leidenschaftlich gern Motorrad fährt, heute eine leichte Maschine braucht, die er mit wenig Kraft im Gleichgewicht halten kann.
Tarek gelang die Flucht nach Deutschland. Die Bürgermeisterin von Felde nahm ihn in ihre Familie auf. Plötzlich hatte er deutsche Geschwister – und er lernte reiten.
Für Tarek ist es wichtig, jenseits der Grenzen seiner Erziehung und seiner Kultur Erfahrungen zu sammeln, selbst wenn dieses ständige Lernen und Ausprobieren viel Kraft erfordert. Er ist mit einer Deutschen verlobt. Seine Kinder sollen später beide Kulturen kennenlernen. Ihm kommt es weniger darauf an, eine kulturelle Identität zu bewahren, als darauf, die Welt zum Guten zu verändern. „Wichtig ist nicht, wer Tarek ist, sondern was Tarek macht“, so fasst er seine Haltung zusammen. Viele seiner Spiel- und Schulkameraden sind im syrischen Bürgerkrieg getötet worden, und in jeden neuen Lebensabschnitt begleiten ihn Erinnerungen an Freunde, die nicht erwachsen werden durften.
Er studiert Politikwissenschaft und Islamwissenschaften und ist schon ein Jahr nach seiner Ankunft in Deutschland in die SPD eingetreten. Sein Vorbild ist Willy Brandt, der aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Norwegen emigrieren musste, ebenfalls eine neue Staatsangehörigkeit annahm, eine neue Sprache lernte und im Exil heiratete. Tarek interessiert, wie die Demokratien in Europa und Nordamerika entstanden sind, was sie verbindet, wie sie sich voneinander unterscheiden und wie sie weiterentwickelt und gestärkt werden können.
Auch Tareks Eltern leben inzwischen in Schleswig-Holstein. Wenn er ihnen von seinem Engagement für die SPD erzählt, fragen sie besorgt, ob er sich auch noch seine zweite Schulter zerschießen lassen wolle. Politik bedeutet für sie, die in einer Diktatur aufwuchsen, Lebensgefahr. Es wäre schön, wenn sie damit ganz und gar unrecht hätten, doch allzu oft erhält Tarek Drohmails, nachdem er ein Interview gegeben hat oder öffentlich aufgetreten ist.
Das Duo Janeway hat ein Song über Tarek geschrieben:
Tareks Song: Gerade Aus

Andrea – aus Buenos Aires nach Molfsee
Andrea besuchte als Kind eine deutsche Schule in Buenos Aires. Viele Schülerinnen und Schüler hatten jüdische Wurzeln – das unterscheidet diese Schule von anderen deutschen Schulen in Argentinien. Bei Sportfesten wurde die Schulmannschaft oft ausgepfiffen, denn auch unter den Deutschen in Argentinien gab es Antisemitismus.
Nach der Schule studierte Andrea Architektur. Gegen den Wunsch ihres Vaters entschied sie sich nicht für eine Privatuniversität, sondern für die staatliche Universität in Buenos Aires. Der Vater strich ihr daraufhin die finanzielle Unterstützung. Sie lernte, sich durchzubeißen.
Schon als Austauschschülerin war sie für ein halbes Jahr in einer deutschen Gastfamilie in Kiel gewesen. Sie brachten ihr sehr viel bei und öffneten ihr Möglichkeiten und Kontakte. In dieser Zeit erweiterte sich ihr Horizont und sie lernte viel über sich selbst. Nach dem Studium machte sie ein Praktikum in einem Kieler Architekturbüro. In Deutschland würden Häuser nach ganz anderen Gesichtspunkten geplant, erklärt sie, nicht nur wegen der unterschiedlichen Architekturtraditionen, sondern schlicht deshalb, weil die Sonne aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung einfalle.
In Kiel verliebte sie sich in einen Mann iranischer Herkunft. So waren in dem Haus in Molfsee, das sie umbaute und sich zur Sonne hin öffnen ließ, bald Familienangehörige aus Argentinien und aus dem Iran zu Besuch – manchmal für Monate. Heute ist Andrea geschieden, die obere Etage vermietet sie an eine Familie aus Singapur, im Erdgeschoss hängt eine riesige Schwarzweißfotografie ihrer drei erwachsenen Söhne. Als ihre Ehe zerbrach, war sie tieftraurig. Sie machte eine Therapie, damit ihre Kinder nicht unter ihrer Traurigkeit litten. Wenn sie heute Kinder aus kürzlich nach Deutschland geflüchteten Familien an der Hand ihrer Eltern sieht, denkt sie wieder: Kinder sollten nicht zu lange mit traurigen Eltern leben. Obwohl sie Deutschland schon lange verbunden war, bevor sie sich in Molfsee niederließ, und obwohl sie Deutsch in der Schule gelernt hatte, traf sie in bestimmten Momenten ihres Lebens das Fremdsein mit voller Wucht. Wie muss es dann denjenigen ergehen, die unvorbereitet und ohne berufliche Perspektive herkommen? Sie wünscht sich Angebote für geflüchtete Menschen, die auf sanfte Weise die Traumatisierungen durch Krieg und Gefahr lindern, etwa Erlebnisworkshops, Meditationskurse für Mütter, Kreativkurse oder gemeinsames Musizieren. Diese Angebote sollten Menschen darin unterstützen, ihre Ressourcen durch positive Erfahrungen zu stärken und aufzubauen.
Ein Interview mit und einen Song über Andrea gibt es hier:
Andreas Song: Home
Andreas Interview

Madjid – aus dem Iran nach Felde
In Madjids endloser WhatsApp-Kontaktliste sind die persischen und afghanischen Vornamen nummeriert. Sein guter Freund Ferry zum Beispiel heißt Ferry5, um ihn von den anderen Ferrys zu unterscheiden. Madjid ist in den achtziger Jahren zum Ingenieursstudium nach Deutschland gekommen, war Bauunternehmer und zwischendurch auch einmal jahrelang Eisdielenbesitzer. Die Eisdiele führte er gemeinsam mit seiner Frau, um mehr bei ihr und seinen beiden inzwischen erwachsenen Töchtern zu sein.
Sein WhatsApp-Verzeichnis wuchs und wuchs, als 2015 geflüchtete Familien in sein Dorf kamen. Er nutzte sein berufliches und privates Netzwerk, um Hilfe zu organisieren, zuerst Fahrräder und warme Kleidung, später Jobs und Lehrstellen. Den Neuankömmlingen sagte er, dass sie selbst die Initiative ergreifen müssten, um das neue Land kennenzulernen. „Aus allen ist etwas geworden“, stellt er zufrieden fest. Alle, die vor sechs Jahren orientierungslos und erschöpft in Felde ankamen, haben Wohnungen und Arbeitsstellen gefunden. Die WhatsApp-Gruppe ist bis heute ein Forum, in dem sie einander beistehen, Informationen austauschen, zu Geburtstagen gratulieren. Auch ein paar deutsche Unterstützerinnen und Unterstützer sind bis heute Mitglied und helfen gelegentlich auf stille Weise. Madjids WhatsApp-Gruppe ist ja keine Organisation, sie hat keinen Namen und zieht selten Aufmerksamkeit auf sich.
Sein Rezept für Glück? Er kratzt sich am Kopf, draußen wartet der Nachbar, mit dem er eine Garage baut, eine schnelle Antwort muss her: „Etwas tun. Etwas geben.“
Ein Interview mit Madjid gibt es hier:
Madjids Interview

Daud – aus Somalia nach Damp
Das somalische Wort für „gut“ ist fünf Silben lang. Eigentlich erstaunlich, weil „gut“ doch ein Wort ist, dass man oft benutzt, da ist kürzer praktischer. Daud macht sich gern Gedanken über Sprachen. Seine Muttersprache Somali hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant entwickelt. 1960 vereinigten sich die ehemaligen Kolonien Italienisch-Somaliland und Britisch-Somaliland zu Somalia, 1972 wurde Somali Amtssprache und nahm eine Vielzahl neuer Fachbegriffe in sich auf. Wörter wie „formaggio“ zeugen noch von der vorausgegangenen Unterdrückung durch die Italiener, aber können die Worte etwas dafür?
Daud lässt sich das Wort „formaggio“ auf der Zunge zergehen. Es bringt ihn zu seiner zweiten Leidenschaft, dem Kochen. Obwohl er für andere Geflüchtete exquisite somalische Gerichte zubereitet, ist ihm das Brot am wichtigsten, Ciabuti, mit Fleisch, Eiern oder Formaggio, gern mit Tomaten, oder aber in Tee oder Suppe getaucht.
Daud macht keine Zukunftspläne, denn er hat wegen einer alten Verletzung an Hüfte und Oberschenkel chronische Schmerzen. Vor kurzem ist er in eine kleine Wohnung neben der Flüchtlingsunterkunft umgezogen, doch er kommt oft rüber, um sich um Neulinge wie Abbas, ebenfalls aus Somalia, zu kümmern, zu übersetzen, zu kochen – er schafft gute Momente in der Gegenwart.

Mazi – aus Teheran nach Felde
Mazi war 19 Jahre jung und mutig. An der Universität, an der er Wirtschaftsingenieurwesen studierte, nutzte er eine öffentliche Präsentation, um die Unterdrückung in der Islamische Republik Iran zu kritisieren. Auch eines seiner Gedichte las er vor. Kurz darauf erfuhr er, dass er ab jetzt vom Geheimdienst beobachtet wurde.
Sieben schöne und gefährliche Jahre lebte er noch im Iran, schloss sein Studium ab, schrieb viel, pflegte Freundschaften und kritisierte das Regime, so weit es möglich war. Er war im Urlaub, als seine Eltern ihn anriefen und warnten. Die Polizei suche ihn, um ihn zu verhaften. Gerade noch rechtzeitig floh Mazi 2014 aus dem Iran. Bekannte der Familie und seine Geschwister sammelten das Geld für seine Flucht. Im Iran hätte Mazi dafür eine Wohnung kaufen können. Seine Eltern hat er seitdem nicht wiedergesehen.
Heute betreibt Mazi, unterstützt von seiner Freundin, ein Café in Felde. Kuchenbacken hat er von seiner Schwester gelernt, die ebenfalls aus dem Iran fliehen musste und ein Café im Kieler Umland führt. Seine Tage sind lang, zwölf Stunden oder mehr vergehen von den Einkäufen am Morgen bis zum späten Feierabend. Er bringt Leben in das kleine Lokal am Bahnhof, donnerstags findet hier ein iranischer Spieleabend statt, freitags lesen und musizieren Künstlerinnen und Künstler. Sein Weg zum Cafébesitzer war kurvenreich: Er wollte in seinem Fach einen weiterführende Abschluss machen, doch sein Studium wurde in Deutschland nicht anerkannt. Förderung für ein neues Studium bekam er jedoch nicht, weil er im Iran bereits einen Abschluss gemacht hatte. Eine Karriere als Berater bei der Agentur für Arbeit scheiterte an seinen damals noch zu geringen Deutschkenntnissen, eine Laufbahn als Lokführer daran, dass er die Farbe grün nicht gut erkennen kann. Die ganze Zeit über engagierte er sich ehrenamtlich, begleitete andere Geflüchtete zu Behörden, übersetzte Englisch-Persisch und besuchte später gemeinsam mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern von der ZBBS In Kiel (Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten e.V.) Schulen, um seine Geschichte Jugendlichen zu erzählen.
Ein Café zu betreiben, Menschen zusammenzubringen und etwas über sie zu erfahren sei ein Traum, sagt Mazi. Besonders gern verkauft er Eis an Kinder, er genießt ihre Freude. An schwierigen Tagen schaut er über die Felder Richtung Eider und atmet tief durch. Alles so friedlich hier.

Hanna – aus Polen nach Eckernförde
Hanna zog mit Anfang 20 aus Polen zu ihrer Schwester, die schon in Eckernförde lebte. Sie erinnert sich, wie schwer es war, hier Kontakte zu knüpfen, wie fremd sie sich ohne Eltern, Freunde und Freundinnen vorkam. Ein paar Jahre hat sie, zurückhaltend wie sie ist, schon gebraucht, um sich heimisch zu fühlen.
Inzwischen ist der gefühlte Abstand zwischen beiden Ländern geschrumpft. Sie hat sich verliebt und geheiratet, ihre beiden Kinder sind Teenies und sprechen immerhin so viel Polnisch, dass sie sich mit den Großeltern in Polen unterhalten können. Die Unterschiede zwischen beiden Kulturen kamen ihr nie besonders groß vor. Sie wundert sich jedes Mal, wenn sie nach polnischer Lebensart und polnischen Gepflogenheiten gefragt wird, nach Unterschieden zu Deutschland, denn die Liste der Gemeinsamkeiten erscheint ihr viel länger.

Lidija – von Kasachstan nach Eckernförde
Lidija erlebte eine glückliche und geborgene Kindheit in Kasachstan. Sie war das jüngste von neun Kindern und in ihrem Dorf gab es viele Spielgefährten, mit denen sie den ganzen Tag draußen herumtobte. Heute ist ihr Dorf fast verlassen, denn hier lebten vor allem Nachfahren deutscher Einwanderinnen und Einwanderer. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam es zu nationalistischen Exzessen gegen sie, sie wurden als „Nazis“ beschimpft, geschlagen und bedroht. Lidija, die früh verwitwet war, floh mit zwei Kindern und einem Koffer nach Deutschland. Ihre Vorfahren hatte einst Katharina II ins Land geholt, ihre Urgroßeltern und Großeltern wurden unter Stalin nach Kasachstan zwangsumgesiedelt. In Viehwagons brachte man sie in die kasachische Einöde, ohne Vorräte, ohne Saatgut und ohne Gerätschaften. Die Menschen gruben Erdlöcher, viele starben, andere wie Lidijas Familie überlebten und errichteten Dörfer. Lidija war seit ihrer Flucht nach Deutschland nicht mehr in Kasachstan. Sie hat dort zuletzt zu viel Schreckliches erlebt.
In Eckernförde hat sie, die gelernte Buchhalterin, eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht, dann als Schulbegleiterin gearbeitet und bald beginnt sie eine Fortbildung zur Erzieherin. Obwohl sie auf allen Zertifikaten beste Noten hat, macht sie sich Sorgen wegen ihres Deutsch. Es ist ihre Muttersprache – allerdings mit dem Akzent der Russlanddeutschen und ohne die vielen neuen Wörter, die in den vergangenen Jahrzehnten Eingang in die deutsche Sprache fanden. Für ihren Enkel Dima, der demnächst in den Kindergarten kommt, werden sie kein Problem sein.
Das Duo Janeway hat einen Song über Lidija geschrieben:
Lidijas Song: Mein Schönes Dorf

Gopal – aus Afghanistan nach Gettorf
Gopals Verwandte leben verstreut in verschiedenen asiatischen und europäischen Ländern. Im Herbst 2021 sind einige Angehörige aus Kabul nach Indien geflohen, das sie bereitwillig, auch ohne Pass und Visum, aufnahm. Nun wohnt niemand aus dieser weit verzweigten hinduistischen Familie mehr in Afghanistan.
Schon 1996, als die Taliban zum ersten Mal Kabul einnahmen, forderten sie seine Frau auf, Burka zu tragen, schlossen Tempel und drohten, seine Schwägerin zu entführen, wenn er nicht 20 000 Dollar Bestechungsgeld auftreibe.
Nun besucht er die Hindutempel in Hamburg, wo er gleich nebenan Reis und andere Lebensmittel aus Indien kaufen kann. Er kocht in der Niederlassung einer Restaurantkette in Eckernförde. Neben den Standardgerichten sind dank Gopal ein paar indische Köstlichkeiten auf der Speisekarte aufgetaucht. Obwohl er seit 15 Jahren in Deutschland lebt, hat er bislang keinen sicheren Aufenthaltsstatus und durfte lange Zeit nicht einmal jobben. Statt eines Reisepasses besitzt er einen ganzen Stapel Papiere, die er immer wieder in der afghanischen Botschaft in Berlin erneuern lassen muss. Sogar dort, weit weg von Afghanistan, wird er wegen seines Glaubens beschimpft. Dabei erinnert er sich gern daran, wie er als Junge mit dem Fahrrad durch Kabul fuhr. Er hofft, dass alle Mitglieder seiner großen Familie die Feste des Hindukalenders irgendwann einmal wieder am selben Ort feiern werden.

Sajad – aus dem Iran nach Vogelsang-Grünholz
Menschenrechte sind das Thema, das Sajad an Deutschland am meisten interessiert. Wie ist es eigentlich möglich, das Deutschland Asylsuchende aufnimmt, wie wurden die Menschenrechte in der Verfassung verankert, wer hatte überhaupt die Idee? Seit einem Jahr lebt er hier und es fasziniert ihn, dass ein Staat sich den Schutz des Lebens und der Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger zur Aufgabe macht.
Sajad ist im Iran geboren, hat aber afghanische Wurzeln. Seine Familie gehört zu den ca. drei Millionen afghanischer Flüchtlinge, die vor den Kriegen in Afghanistan über die Grenze ins Nachbarland flohen. Viele leben schon seit mehreren Generationen im Iran. Dort war er Medizintechniker. Mit fünfzehn hat er angefangen, in einer Apotheke zu arbeiten, und sich immer wieder weitergebildet.
Die menschenleeren Straßen in Vogelsang-Grünholz machen ihn manchmal traurig. Er vermisst Menschen, die draußen sitzen, sich unterhalten, herumwuseln. Ein großes Glück ist, dass seine Frau mit ihm hier ist. Sie ist eine ziemlich gute Fußballerin.

Nadja – aus der Region Alma Ata nach Eckernförde
Nadja stammt aus einem Dorf, von dem aus die Großstadt Alma Ata gerade noch zu hören ist. Die Berge, die Alma Ata umgeben, liegen in Sichtweite. Nadja liebte das Dorf und kannte Alma Ata wie ihre Westentasche. In ihre Schulklasse gingen Jugendliche mit siebzehn verschiedenen Nationalitäten, aus russischsprachigen, deutschsprachigen, kirgisischen, georgischen, armenischen und kasachischen Familien. Während im Land nach dem Zerfall der Sowjetunion der Hass zwischen den Volksgruppen wütete, hielten Nadja und ihre Schulfreundinnen und –freunde zusammen. Noch heute sind sie alle durch eine WhatsApp-Gruppe verbunden, täglich gehen Nachrichten hin und her: Wer hat Enkelkinder bekommen, wer ist krank, wer wieder gesund? Vor allem wegen der schlechten Berufsaussichten in Kasachstan sind sie als junge Menschen ausgeschwärmt. Heute schicken sie sich Bilder von ihren Gärten in ganz Europa.
Nadja liebt Alma Ata mit seinen Skiliften, Parks und dem besonderen Licht, das von den schneebedeckten Bergkuppen in die Stadt fällt. Drei Mal konnten sie und ihr Mann sich in den vergangenen 20 Jahren eine Urlaubsreise dorthin leisten. Den jungen Leuten, die heute in Kasachstan leben, wünscht sie, dass die Wirtschaft sich entwickelt, damit sie bleiben können.

Abbas – aus Somalia nach Damp
Abbas ist seit einigen Wochen in Deutschland. Seine Sportschuhe sind sein wichtigstes Kleidungsstück, denn wenn ihm alles Neue zu viel wird, wenn ihm in der Flüchtlingsunterkunft die Decke auf den Kopf fällt oder Erinnerungen an die Flucht ihn bedrängen, rennt er los und hält lange nicht an.
Der wichtigste Mensch in seinem Leben ist Daud. Daud ist in den Vierzigern, etwa doppelt so alt wie Abbas, und kommt auch aus Somalia. Nur mit ihm kann er reden, von allen anderen trennen ihn Sprachbarrieren, denn er spricht weder Deutsch noch Englisch und auch nicht Arabisch oder Dari wie andere Geflüchtete in der Unterkunft.
Samstags nimmt Daud ihn mit nach Kiel, wo sich in der Nähe des Hauptbahnhofs die somalische Community trifft, um zu plaudern, zu lachen, Karten zu spielen, gemeinsam zu essen – eine Pause von der Einsamkeit.

Joan – Von Glasgow über Italien und Frankreich an den NOK
Als Joan klein war, sprach sie mit ihren Freunden auf der Straße Schottisch, zuhause jedoch Englisch, wie es sich für eine Tochter aus gebildeter Familie gehörte. Schon da zeigte sich ihr Talent, durch sprachliche Anpassung chamäleongleich die Grenzen zwischen sozialen Sphären, Regionen und Ländern zu überwinden.
Aus Schottland zog die Familie nach London und bald darauf, als Joan neun Jahre alt war, nach Italien, in die Nähe von Bergamo, immer den Arbeitsaufträgen ihres Vaters, eines Ingenieurs, folgend. Sie verstand kein Wort Italienisch, aber sie lernte es bald von den Dorfkindern, und als sie Jahrzehnte später als Erwachsene eine Straßenbahn in Rom bestieg, hätte sie sich immer noch mit der Kinderschar unterhalten können, die um sie herum wimmelte. Von Italien ging es nach Paris, als sie elf war. Sie musste ihre Katze zurücklassen und das italienische Dorf gegen die französische Metropole eintauschen. Unterrichtet wurde sie zuhause, und doch fand sie neue Freundinnen. Außerdem entdeckte sie ihre Liebe zum Lesen und ihre Neugier auf Lebensgeschichten anderer Menschen. Dieser Forschergeist half ihr bei den nächsten Lebensstationen: Schule und Hochschulreife in Großbritannien, Studium von modernen Fremdsprachen und Philosophie mit Aufenthalten in Tübingen und Brest. In Brest lernte sie ihren Mann, einen Kieler, kennen. Und so kam es, dass sie heute den Nord-Ostsee-Kanal sieht, sobald sie aus der Haustür tritt. Ihre Kinder sind in Deutschland geboren. Ihre Katzen lobt sie auf Englisch und ermahnt sie auf Deutsch. Ihr zweiter Mann, ein ehemaliger Studienkollege, war Engländer und zog ihretwegen nach Norddeutschland, das ihr anfangs so seltsam flach und extrem windig vorgekommen war.
Noch heute unterrichtet Joan Englisch, es macht ihr Spaß, die englische Literatur und den way of life zu vermitteln. Über die Geschichten der Menschen, die ihr hier begegneten, und über eigene Erlebnisse in verschiedenen Ländern hat sie Bücher geschrieben, zum Beispiel „Dreiecksplatz“ über die Leute, denen sie am Kieler Dreicksplatz in ihren Mittagspausen als Dozentin begegnete. Sie kann gut zuhören. Die Menschen breiten ihre Erfahrungen vor ihr aus.
Joans Interview

Charlotte – aus Paris über Elsass, Potsdam und Bretagne nach Kronshagen
Kronshagen war der Ort, wo Charlotte wegen des monatelang diesigen Wetters zum ersten Mal im Leben beim Radfahren eine Leuchtweste trug und wo sie ihrem Mann, sich selbst und den Kindern eine Vitamin-D-Kur verordnete. Geboren wurde sie in einer viel sonnigeren Gegend, den Pyrenäen, aufgewachsen, zur Schule und zur Universität gegangen ist sie in Paris. Während in Marcel Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“ der Geschmack und Geruch eines Gebäckstücks, der Madeleine, den Helden in die Kindheit zurückversetzt, weckt bei Charlotte der Gestank der Pariser Metro im Sommer Kindheitserinnerungen.
Die Universitätskarriere ihres Mannes führte die Familie an viele Orte, zunächst in ein Dorf im Elsass, dann nach Potsdam, später nach Rennes in der Bretagne, und schließlich kauften sie ein Haus in Kronshagen. Charlotte fand als studierte Französischlehrerin überall Arbeit und entdeckte die Schönheit der verschiedenen Wohnorte und Landschaften. Auf den Seen rund um Potsdam lief die Familie im Winter Schlittschuh, im Sommer gingen sie schwimmen. Der Lebensrhythmus der Potsdamer*innen erschien Charlotte, der Pariserin, entspannt, und die Menschen in Brandenburg hatten mit ihr als echter Ausländerin mehr Geduld als mit den Westdeutschen.
Für ihre Kinder, so glaubt sie, war später der Wechsel vom französischen Rennes zurück ins deutsche Schulsystem eine Herausforderung, zumal sie ihnen in Deutschland viel weniger helfen konnte. Zurzeit haben sie, anders als viele Gleichaltrige, keine Pläne, ihr Studium für ein Erasmusjahr oder andere Auslandsreisen zu unterbrechen. Vielleicht brauchen sie mal eine ruhige Zeit, überlegt Charlotte. Jedenfalls denken sie nicht einspurig, können Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und sind Europäer aus Erfahrung und Überzeugung.
Charlotte, die sich auch am Centre Culturel Français in Kiel engagiert, bringt ihren Schüler*innen nicht nur die französische Sprache nahe, sondern ab und zu auch französisches Tempo und Temperament. Zum Beispiel, meint sie und verschließt ihre Lippen mit einem imaginären Reißverschluss, dürfe man einander in Deutschland beim Reden nicht unterbrechen, in Frankreich dagegen schon. Wahrscheinlich stellten die Deutschen deshalb das Verb ans Ende ihrer endlos langen Sätze, damit sie in aller Ruhe ausreden könnten.
Die Songs von Janeway
Memo mischen
Die Menschen, die uns für das Memospiel ihre Geschichten erzählt oder unser Projekt unterstützt haben, sind einander beim Essen, bei Workshops oder bei Arbeitstreffen begegnet. Gespräche zu einigen Themen haben wir hier dokumentiert.
1 Hilfe
Barbara: Als die Fremden hierher kamen, hatte ich ein Gefühl, wie es ihnen gehen kann. Und zwar auf einer anderen Ebene vielleicht als Menschen, die dieses Gefühl nicht so in sich kennen.
Ariana: Wenn man versucht hat, ihr etwas zu erzählen – sie wusste, was man sagen wollte. Wir konnten ja nicht so Deutsch sprechen, dass man Gefühle beschreiben kann. Und dann hat sie gesagt, das meinst du so – und das ist zutreffend gewesen. Und dann hat man gesagt: Genau so, Barbara, genau das. Wie hat man sich bei ihr gefühlt? Zuhause. Das Eis war, wenn man bei Barbara war, weg, geschmolzen. Ein tolles Gefühl, und das vergisst man nicht. Also, mir hat’s geholfen. Man ist zu Barbara gegangen, man hat Probleme und man hat diese Probleme auf den Tisch gelegt und versucht, Lösungen zu finden, die wirklich auch Lösungen waren. Und wenn man das erlebt, das gibt Sicherheit, Geborgenheit, Zuhause. Wo hat man das? Das hat man zuhause. Als Flüchtling bist du gelähmt, bist aber auch gesperrt, wenn du selber aus diesem Lähmen raus möchtest. Man war in Ketten. So hab ich das empfunden. Ich bin in Ketten, ich kann nichts machen, ich darf nichts machen, weil die Gesetze so sind. Aber das jemand da ist und einem auch erklärt, nicht nur die Gesetze, sondern warum es so ist, und: Komm, wir finden einen Weg! Für dich und für dich und für dich. Wie viele Leute hat Barbara begleitet!
Barbara: Wir haben die Menschen besucht, das war im Grunde das Wesentliche. Wir haben sie immer besucht. Ich habe sie dann später auch zu mir eingeladen, das würde ich nicht noch einmal machen, das ist eine Überforderung. Das wichtigste für die deutschen Helfer ist die Abgrenzung, um das überhaupt machen zu können, und das ist schwer, wenn du deine Wohnung öffnest. Was ich gelernt habe: Dass es unendlich komplizierter ist, alles, das Leben überhaupt, unendlich viel schwieriger als ich das vorher überhaupt geahnt habe, und auch, dass Vor- und Nachteile und, wenn du so willst, Gut und Böse, ganz anders verteilt sind als ich das bis dahin in so einem normalen Beamten-, Lehrerleben dachte. Ich bin auch natürlich recht naiv an diese ganze Chose rangegangen: Flüchtlinge sind arme Menschen, armen Menschen muss man helfen. – Die müssen sich selber helfen! Und wenn, dann muss man zeigen, was sie selber machen können. Sich einzubilden, man könnte denen helfen, das ist sowas von arrogant und dumm.
Ariana: Was meinst du mit „helfen“!? Für mich ist „helfen“ gewesen, dass jemand sich für mich interessiert. Für meine Geschichte.
Barbara: Das ist richtig.
Ariana: Das ich für jemanden nicht die Nummer bin. Das ist helfen.
Barbara: Das ist Hilfe gewesen?
Ariana: Ja. Du hast zugehört, du hast mich unterrichtet, ja, du hast mir Weg gezeigt, und den Weg bin ich doch alleine gegangen.
Barbara: Ja, genau.
2 Stadt und Land
Michael: Wo hast du vorher gewohnt? Ich meine, hast du in einem Dorf gewohnt oder in der Stadt?
Mehdi: In der Stadt. Ich habe für eine Versicherung gearbeitet.
Michael: Das heißt, du hattest noch nie auf dem Dorf gewohnt?
Mehdi: Nein. Als ich angekommen bin, habe ich gesehen, alle Straßen mit Asphalt, aber klein, so wenig Menschen. Wie soll ich hier ein Leben machen? Meine Eltern haben in einem Dorf gewohnt, da war jeden Samstag Market.
Michael: Markt? Zum Einkaufen?
Mehdi: Einkaufen und unterhalten und sitzen und Tee trinken. Hier gibt es das nicht. Alle Menschen sind in ihren Häusern.
Zahar: Ich habe hier gekommen, gesehen und geweint. Wie soll ich Leute kennen lernen? Aber ist gut für Kinder. Schule klein, viele deutsche Kinder, nur ein, zwei Kinder aus anderen Ländern. Die Kinder lernen gut Deutsch.
Mehdi: Ja. Rachelle kann gut Deutsch. Sie ist erst ein Jahr hier und sie ist fünf, ich bin zweieinhalb Jahre hier, aber sie kann es besser als ich.
Zahar: Ich habe eine Freundin in Rendsburg – fast alle Kinder in der Klasse von ihrer Tochter sind nicht deutsch. Sie lernen nicht gut. Hier, wenig Kinder, lernen gut.
Mehdi: Für Kinder ist das Dorf gut.
Zahar: Man kann nicht einkaufen. Einmal in der Woche fahre ich in die Stadt und kaufe alles. Mit dem Bus. Ist schwer.
Michael: Schwere Taschen. Schwer zu tragen.
Zahar: Schwere Taschen, ja.
Michael: Mehdi, du hast doch einen sicheren Status. Warum ziehst du nicht um?
Mehdi: Ich finde keine Wohnung. Kiel keine Wohnung. Flensburg keine Wohnung. Eckernförde keine Wohnung. Nur hier, an der Ampel.
Michael: An der Ampel?
Mehdi: Ja, da.
Zahar: Mehdi hat eine Wohnung andere Seite von Straße.
Michael: Du hast hier im Dorf eine Wohnung gefunden?
Mehdi: Ja. Nur hier.
Zahar: Er wollte nicht mehr im Hotel wohnen.
Mehdi: Aber komme jeden Tag.
Beide lachen.
Zahar: In Rendsburg gibt es Wohnungen. Gibt es Arbeit bei Verwandten. Wenn ich darf, möchte ich nach Rendsburg ziehen. Aber wenn ich ein Kind habe, ist es nicht gut. Für Kinder ist es nicht so gut. Weil in der Schule alle Kinder nicht deutsch. Wenn es hier einen Laden gibt. Aber gibt es nicht.
Mehdi: Wenn es hier einen Laden gäbe, könnten wir da arbeiten. Kisten auspacken, verkaufen.
Zahar: Super.
3 Sprachen
Abieyuwa: Hier sind wir in Norddeutschland.
Rascha: Norddeutschland?
Abieyuwa: Ja, hier ist Norddeutschland. Mein Mann kommt aus Krefeld, und wir haben zuerst in Krefeld gelebt. Krefeld ist in der Mitte von Deutschland.
Rascha: In der Mitte. Nicht Süden und nicht im Norden.
Abieyuwa: Genau. Und da sind die Menschen anders, ein bisschen offener vielleicht. Sie reden mehr miteinander. Sie quatschen.
Rascha: Ist es leichter, Freunde zu finden? In der Mitte?
Abieyuwa: Leichter, ich weiß nicht. Wir gehen nicht so viel weg, weil unser Sohn, bei ihm wurde frühkindlicher Autismus diagnostiziert. Jetzt ist er schon groß, aber er kann nicht allein bleiben. Deshalb gehen wir nicht viel weg. Aber, kann sein, in Krefeld war es ein bisschen einfacher.
Rascha: Meine Kinder gehen in den Kindergarten. Sie spielen mit anderen Kindern. Sie lernen Deutsch.
Abieyuwa: Unser großer Sohn ist in Kiel. Er studiert.
Rascha: Und mein Mann ist Altenpfleger. Alle sagen: Wann kommt Mohammed? Er ist lieb. Aber ich bin viel zuhause. Ich habe Kurse gemacht. B1, B2.
Abieyuwa: Ich habe keine Kurse gemacht, ich hatte kein Recht auf Kurse. Ich habe einfach mit den Leuten gesprochen. Und immer die Nachrichten gesehen. Und meinen Mann gefragt, was erzählen die da. Zuerst haben wir viel Englisch gesprochen, aber dann immer mehr Deutsch.
Rascha: Ich immer zuhause. Lernen aus Büchern. Aber nicht sprechen. Lesen, aber nicht sprechen.
Abieyuwa: Zum Glück hatte ich meinen Mann. Er hat gesagt, wenn du jetzt hier bleiben willst, wenn wir heiraten, dann musst du die Sprache auch richtig lernen. Mich hat das interessiert. Ich habe ihn immer gefragt: Was heißt das? Wie sagt man das? Ist das richtig? Als unser erster Sohn geboren wurde, da konnte ich schon ganz gut Deutsch, da bin ich vorher ganz alleine zum Arzt gefahren und habe mit den Leuten geredet.
Rascha: Ich habe angefangen, hier an der Schule zu arbeiten, und plötzlich, da waren so viele Menschen. Guten Morgen, Rascha. Wie geht’s? Schön, das ist sehr schön. Und dann habe ich angefangen zu sprechen. Viele Fehler.
Abieyuwa: Ich habe auch viele Fehler gemacht, ich mache immer noch Fehler, aber nach und nach wurde es immer besser.
Rascha: Sehr viele Fehler. Die Grammatik ist noch nicht gut, aber das kommt mit der Zeit.
Abieyuwa: Ich habe zuerst Bücher auf Englisch gelesen und dann auf Deutsch.
Rascha: Ich wollte Englischlehrerin werden. Meine Schwester war Englischlehrerin in Aleppo. Aber jetzt Englisch raus aus meine Kopf. Deutsch rein.
Abieyuwa: Ich vergesse meine Heimatsprache. Manchmal am Telefon weiß ich nicht, wie man etwas sagt. Es ist weg.
Rascha: Ja. Ich spreche mit mein Mann auf Arabisch, nicht vergesse. Aber abends bin ich so müde. Ganze Kopf voll Deutsch.
4 Sicherheit
Maya: Meine Tochter fährt jeden Tag mit dem Bus. Manchmal dauert die Schule lange, dann läuft sie im Dunkeln nachhause. Manchmal sie läuft allein, manchmal mit anderen Mädchen.
Lidija: Es ist das Paradies. Oder? Das Paradies.
Maya: Es ist sicher. Keiner hält sie an. Keiner tut etwas. Sie fährt mit dem Bus und kommt im Dunkeln nachhause. Sie kann zur Schule gehen.
Lidija: Die Menschen in Deutschland denken, das ist normal.
Maya: In meinem ganzen Leben bin ich nicht im Dunkeln nachhause und sie kann. Sie kann später studieren.
Lidija: Ja, sie ist noch so jung.
A: Für mich ist es nicht sicher. Deshalb mache ich nicht mit bei dem Spiel.
Lidija: Warum nicht?
A: Die Leute, die mit denen wir hier sind, die sind auch hier. Wir haben Geld gegeben. Und wenn sehen, wollen sie mehr Geld. Es ist nicht sicher.
Maya: Wir sind mit dem Flugzeug gekommen, aber mein Sohn ist noch in Ägypten, weil er 18 Jahre alt. Das ist schwer. Immer denken an ihn. Warum ist er nicht hier?
A: Mit dem Flugzeug?
Maya: Ja.
A: Warum mit dem Flugzeug?
Maya: Das ist ein Flugzeug von der Regierung.
A: Deutsche Regierung?
Maya: Ja. Frauen und Mädchen, alle sicher.
A: Das ist gut.
Maya: Aber mein Sohn nicht.
Lidija: Ich bin auch mit dem Flugzeug gekommen, nur mit einem Koffer, und mit meinen beiden Kindern, wir mussten schnell weg. Die Leute haben uns beschimpft, weil wir Deutsche waren.
A: Deutsche?
Lidija: Deutsche in Kasachstan. Es war ein schönes Dorf, aber ich fahre nicht zurück. Mein Sohn wollte, dass wir da Urlaub machen, er fragt, was ist das für ein Land, wo er geboren ist. Zeig’ mir, Mama, aber ich sage nein. Ich habe gern dort gelebt, aber jetzt, wenn ich an mein Dorf denke, nein.
Maya: Nicht denken zurück. Denken an, an die –
Lidija: Zukunft? Ich mache eine Weiterbildung. Ich lerne und das hilft mir. Wenn ich lerne, denke ich nicht an schlimme Sachen.
5 Hunde
Zahar: Sie sind ja nicht schlimm, aber man möchte sie nicht zuhause haben, oder?
Hanna: Einen Hund?
Zahar: Sie stinken. Auf der Straße ja, aber nicht zuhause.
Hanna: In Polen haben viele Leute Hunde, aber sie gehen nicht in die Schule.
Zahar: Die Hunde gehen in die Schule? Hier?
Hanna: Damit sie sich benehmen. In Polen denken die Leute, es gibt gute Hunde und es gibt schlechte Hunde, da kann man nichts machen.
Zahar: Hunde gehen in die Schule? Wer ist Lehrer, Hund oder Mensch?
Hanna: Ein Mensch.
Zahar: Das ist ein Witz?
Hanna: Wir hatten auch einen Hund, einen kleinen, süßen.
Zahar: Geht er zu Uni?
Hanna (lacht)
Zahar: Nein?
Hanna: Die Leute unterhalten sich über Hunde, ach, ist er süß, ist er brav, was hat er gemacht, ist er krank? Mit einem Hund lernst du Leute kennen. Kannst du viel Deutsch reden.
Zahar: Habe ich gesehen, gibt es Hunde mit Mantel. Schöne Mantel.
Hanna: Eben. Und dann kannst du dich unterhalten: Wo haben Sie den Mantel für Ihren Hund gekauft?
Zahar: Ich habe den Mantel für meinen Hund in der Stadt gekauft. Richtig?
Hanna: Richtig.
Zahar: Aber hier darf man keinen Hund. Hier, im Hotel. „Wo haben Sie den Mantel für Ihren Hund gekauft?“ Das ist komisch.
6 Großeltern aus zwei Kulturen
M.: Wenn mich jemand fragt, was ich bin, dann denk’ ich nicht wirklich daran, dass ich einen deutschen Pass hab, sondern für mich bin ich halt dänisch und türkisch, weil das halt so ist. Das ist halt meine Familie. Ich sprech’ ganz normal Dänisch, aber nicht so gut Türkisch, aber ich würd’s gerne lernen. Mein Papa hatte halt nicht so viel Zeit, uns das beizubringen, weil wir andere Sachen gemacht haben. Wann wir in der Türkei sind und Leute so lange Sätze sagen, dann verstehe ich einzelne Wörter, aber halt nicht alles.
Lisa: Dänisch können die Kinder wirklich perfekt, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ich glaube, dass es für sie ganz normal ist, dass sie da jetzt drei Kulturen haben.
M.: Bei meinem Opa und meiner Oma und meinem Opa in Dänemark, da ist halt ein Unterschied, wenn sie Geschichten aus ihrer Kindheit erzählen, aber ich spüre jetzt nicht unbedingt einen Unterschied, wie sie sich mir gegenüber verhalten. Ich hab bei allen das Gefühl, dass sie mich lieb haben und sich um mich kümmern, und da spür’ ich dann halt nicht wirklich einen Riesenunterschied, ob’s türkisch ist oder dänisch. Sind alles Menschen.
Lisa: Und die kennen sich ja auch alle und alle verstehen sich. Sie können aber nicht ganz so gut kommunizieren, weil meine Eltern nicht so super Deutsch können und mein Schwiegervater kein Englisch.
M.: Wenn meine Oma und mein Opa von meiner Mama mit meinem Vater reden, dann ist es Englisch. Und wenn mein Opa dann da ist, dann Hand- und Gesichtssprache. Es gibt halt schon einen Unterschied, wie Leute halt sind, weil, Mama ist eher so ruhig und Papa ist halt eher so
Lisa: Aufbrausend?
M.: Ich wusste nicht, ob ich’s sagen darf. Ist aber halt so.
Lisa: Temperamentvoller.
M.: Ja und bei mir und meinem Bruder spürt man die Mischung dann halt schon ziemlich, weil in einem Moment bin ich freundlich, im nächsten schreie ich Leute an. Man muss sich dann halt mal hinsetzen und reden. Es sind nicht immer nur die anderen, wie alle glauben, die mal einen Fehler machen. Ich denk’ das ja auch öfters, dass es nur die anderen sind. Ein Tipp ist halt, auch mal darüber nachzudenken, dass man selbst auch Fehler macht. Ohne Reden funktioniert da gar nix.
7 Papiere
Gopal: Passport. Das ist mein Passport. Mein Papier.
Henry: Das alles? Die ganzen Blätter?
Gopal: Ja.
Henry: Hast Du keinen richtigen Pass?
Gopal: Immer zu afghanische Botschaft in Berlin, neue Papier, neue Stempel.
Henry: Guck’ mal.
Gopal: Dein Pass?
Henry: Ja. Ich bin deutsch und Amerikaner.
Gopal: Du kannst überall hinfahren.
Henry: Wir fliegen einmal im Jahr in die USA. Außer jetzt, wegen Corona.
Miri: Nach Disneyland.
Henry: Ja, in Disneyland waren wir auch, beim letzten Mal.
Miri: Warst du schon mal in den USA?
Gopal: Mein Cousin in die USA, ich nein. Keine Pass. Nur hier.
Henry: Du kannst nicht wegfahren? In den Ferien?
Gopal: Ich bin hier, Verwandte in England, Frankreich, India, USA, und möchte gern, besuchen. Feiern alle zusammen.
Henry: Meine Tante wohnt in den USA. Da waren wir mal zu Weihnachten. Sie packen die Geschenke erst am ersten Weihnachtstag aus, das war komisch.
Gopal: Wir feiern auch Weihnachten, mit Nachbarn, aber auch Hindufeste, mit Familie. Manche Familie in Hamburg. Hamburg fahren. Aber manche Familie in Great Britannien, nicht fahren. Nur hier. Warte, hier.
Henry: Whatsapp? Das machen wir auch. Bildanruf.
Gopal: Immer Whatsapp, fünfzehn Jahre. Kein afghanischer Pass. Kein deutscher Pass. Kein Arbeiten.
Miri: Du arbeitest nicht?
Gopal: Doch arbeiten, aber kurz erst. Arbeitserlaubnis. Kochen im Restaurant.
Henry: Ich dachte, alle können einen Pass haben, wenn sie vierzehn sind.
Gopal: Früher Pass, arbeiten im Geschäft von Cousin in Kabul. Dann Taliban.
Miri: Alle müssen einen Pass haben.
Henry: Einen internationalen Pass. Wenn man rausgeworfen wird aus seinem Land, dass man dann in alle anderen Länder darf.
Miri: Dass man sich eins aussuchen kann.
8 Sport
Daud: Abbas rennt. Er geht raus und rennt. Er rennt, wenn er nicht mehr drin bleiben will. Dann rennt er los.
Sejma: Wir spielen auch Fußball.
Ferry: Mit wem?
Sejma: Zusammen.
Ferry: Nur Ihr hier, nur die Leute, die hier im Hotel wohnen?
Sejma: Mehdi auch. Er wohnt jetzt in einer Wohnung.
Ferry: Aber nicht mit Deutschen?
Sajad: Nein. Ein Freund von mir hat deutsche Freunde, er nimmt mich manchmal mit, ein, zwei Mal im Monat.
Ferry: Wenn du hier leben willst, musst du mit den Leuten reden. Geh’ in den Fußballverein. Mach was.
Sajad: Gibt es nicht Fußballverein.
Ferry: Bist du sicher? Hast du gefragt? Es kommt auch auf Euch an, Mann, es ist nicht gut, wenn ihr alles allein macht. Traut Euch was.
Sajad: Aber es gibt keinen Sportverein. Nur in Eckernförde. Man muss mit dem Bus hinfahren. Hin geht, aber kein Bus zurück.
Daud: Abbas hat in Somalia in einer Mannschaft gespielt.
Sejma: Und hier spielen wir alle zusammen, auch die Kinder. Jemand sagt: Kommt, wir gehen raus, und alle raus, alle spielen. Wir halten zusammen.
Ferry: Ihr müsst Leute kennenlernen. Ihr müsst Leute einladen, ob sie mitspielen wollen.
Sajad: Wir laden die Leute von Unterstützerkreis ein.
Ferry: Gut, aber ich meine junge Leute, so wie du.
Sajad: Die sind hier nicht.
Ferry: Na klar sind die hier.
Sajad: Die sind nur in ihre Häuser.
Sejma: Die sind im Internet.
Alle lachen.
Ferry: Ihr müsst einen Sportverein gründen, wenn es keinen gibt.
Daud: Was heißt gründen?
Sejma: Anfangen.
Sajad: Das ist schwer.
9 Medizin
Ariana: Was ich sagen möchte ist, dass ich es wichtig finde, dass jeder Mensch, wenn er hier ankommt, gründlich untersucht wird. Ich konnte noch nicht sagen, mir tut das weh, mir fehlt etwas. Bis ich das konnte, waren zwei, drei Jahre vergangen, und das dauert zu lange, wenn man eine schwere Krankheit hat.
Barbara: Das ist heute vielleicht anders mit der medizinischen Untersuchung.
Ariana: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Du hast bestimmt Recht, natürlich, es ist dreißig Jahre später.
Barbara: Ja.
Ariana: Aber. Ich weiß es jetzt nicht, was genau gemacht wird, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt großartig Blutuntersuchungen oder sowas gemacht werden. Nach bestimmten Krankheiten vielleicht, Infektionskrankheiten, die nicht übertragen werden müssen. Aber ich finde ganz wichtig, dass gründlich untersucht wird, denn vielleicht –
Barbara: Bei deiner Krankheit, meinst du?
Ariana: Vielleicht wäre es weniger schlimm geworden. Und am Anfang kann man das nicht. Man geht nicht zum Arzt. Und man versteht nicht. Dass die Medizin für einen da ist, egal, ob man versteht oder nicht, das ist wichtig. Und auch, dass man darüber nachdenkt, woher die Leute kommen. In Albanien scheint immer die Sonne. Und diese Frau da –
Barbara: Andrea.
Ariana: Sie kommt aus Argentinien. Da ist es warm. Die Leute brauchen Vitamin D. Sie brauchen bestimmtes Essen, Fisch. Man muss mehr an die Gesundheit denken, gleich, wenn die Leute ankommen.
10 Musik
Mohammad: Was hörst Du?
Eslem: Musik.
Mohammad: Du hörst immer Musik, den ganzen Tag.
Eslem: Nicht Immer. Aber viel. Zuhause habe ich viel gesungen.
Mohammad: Sing mal.
Eslem: Nein.
Mohammad: Warum nicht?
Eslem: Ich habe nicht so eine schöne Stimme. Meine Tante, Cousine, sehr schön.
Mohammd: Darf ich hören?
Eslem: Bitte
gibt ihm einen Kopfhörerstöpsel
Mohammad: Schön. Zuhause haben wir Musik laut gehört. Immer laut.
Eslem: Tanzt du?
Mohammad: Nicht gut. Wenn alle tanzen. Nicht jetzt.
Eslem: Alle singen. Ich singe.
Mohammad: Die Leute sind hier mehr still.
Eslem: Ja. Das ist auch gut, manchmal, das ist die Hausordnung.
Mohammad: Ich war beim Zahnarzt. Da alle Leute waren ganz still.
Eslem: Was denkst du? Sollen sie singen beim Zahnarzt? lacht
Mohammad: Nein, aber, Leben nicht wie beim Zahnarzt, weißt du?
Eslem: Ich habe eine Cousin, in Duisburg. Singt immer, lacht immer. Er singt für mich auf Whatsapp. Hier.
Eslem singt mit.
Mohammad: Schön. Das ist schön.
11 Corona
Sajad: Ich bin zweieinhalb Jahre hier. Zwei Jahre Corona. Ich liege auf meinem Bett, Deutschunterricht nur mit Handy. Immer zuhause. Noch mehr zuhause.
Hamid: Alle sind viel zuhause. Auch die Deutschen. Alle langweilen sind. Aber im Sommer kannst du etwas machen. Im Sportverein. Draußen.
Michael: Alle Leute fühlen sich eingesperrt. Und gehen sich auf die Nerven. Die Kinder wollen mal weg von den Eltern, die Leute wollen ins Kino, Spaß haben. Alle sind’s leid.
Sajad: Wie ein Käfig. Corona ist wie ein Käfig.
Michael: Das ist für alle so.
Sajad: Am Anfang, ich fühle mich wie in einem Käfig. Dann gehe ich raus. Laufe. Dann ist es besser. Gehe ich in die Schule. Viel besser. Dann keine Schule mehr. Ich gehe raus und es ist bisschen besser. Jetzt ich gehe raus und gar nicht besser. Der Käfig ist hier. Klopft an seine Brust.
Hamid: Innen drin.
Michael: Hoffentlich ist es bald vorbei mit Corona, dann kannst du ihn abbauen, auseinanderschrauben. Ich glaube, viele Leute haben so einen Corona-Käfig im Moment.
Sajad: Deshalb sind sie sauer.
Michael: Wie ein Tier im Käfig.
Sajad: Ja, wie wütende Tier.
Hamid: Darfst du nicht zurückbellen.
Sajad: Nein. Nicht bellen. Bitte nicht bellen. lacht
Michael: Es geht vorbei.
Sajad: Ich dachte, Deutschland, das ist Freiheit. Und ist Freiheit, aber auch nicht.
12 Zukunft
Mehdi: Ich bin kein junger Mann mehr. Ich muss an die Zukunft denken, was ich mache. Im Iran habe ich in einer Versicherung gearbeitet. Ich dachte, wenn ich nach Deutschland komme, das ist ein zweites Leben. Ein zweites Mal geboren. Und ich lerne schnell Deutsch, damit ich hier für eine Versicherung arbeiten kann. Ich will nicht in der Küche arbeiten, weil das ist Zeitver-, Zeitver-.
Sajad: Zeitverschwendung.
Mehdi: Ja. Ich überlege immer. Was ist das Richtige? Was soll ich machen?
Sajad: Ich will Elektriker werden. Oder Krankenpflegehelfer. Wie stellst du dir deine Zukunft vor?
Mehdi: Ich habe doch schon gesagt, ich will bei einer Versicherung arbeiten.
Daud: Keine Zukunft.
Sajad: Keine?
Daud: Nein. Mein Bein tut immer weh. Das sind Splitter.
Sajad: Splitter. Von einer Bombe?
Daud: Ja. Bombe. Granate.
Sajad: Du musst ins Krankenhaus.
Daud: Ich war schon im Krankenhaus, aber es tut immer weh. Nicht sehr weh.
Sajad: Ein bisschen?
Daud: Nicht sehr, nicht ein bisschen. Tut weh. Deshalb habe ich keine Pläne. Ich koche, rede. Kein Beruf lernen.
Sajad: Keine Frau?
Daud: Einfach nur leben.
Mehdi: Ich denke immer an die Zukunft. Zweieinhalb Jahre in Deutschland und immer nur denke: Wann fängt die Zukunft an? Erst Deutsch lernen, dann. Dann fängt es an. Aber wann? Wie soll ich Deutsch lernen, wenn ich bin hier nur mit dir? Ich mache Fehler. Du auch. Ich sage wie du. Deutsch lernen muss ich mit Leuten reden. Du bist jung. Daud ist alt. Nein, mittel, sorry, Daud. Ich bin auch mittel, nicht jung, nicht alt. Ich kann nicht ganz neuen Beruf lernen.
Sajad: Du kannst irgendwas machen? Vielleicht?
Mehdi: Als ich nach Deutschland gekommen bin, dachte ich, dass ist mein zweites Leben, ganz neu. Jetzt ist das zweite Leben wieder weg.
13 Enkel
M.: Er ist ganz verliebt in seine Enkel, schlimm ist das, jeden Abend um sechs steht er auf, egal, was man macht, und dann erzählt er ihnen am Telefon eine Geschichte. Verliebt ist er. Andere Leute haben überhaupt keine Chance. Seine Enkel wohnen in Mannheim, das ist ganz schön weit weg. Deshalb telefoniert er immer. Ah, er redet gar nicht mit uns. Viele Leute arbeiten und arbeiten, für ihre Kinder, damit die Kinder hier ein gutes Leben haben, sie arbeiten die ganze Zeit, um was zu schaffen, und sie sehen ihre Kinder gar nicht. Und die Kinder werden richtige Deutsche, die überlegen so wie Deutsche, was soll ich machen, wo finde ich eine Stelle, wie plane ich mein Leben? Und dann kennen die sich gar nicht mehr, die Eltern und die Kinder, weil man nichts zusammen macht. Hey, Opa Ramin, telefonierst du noch? Er ist aus Mannheim zu Besuch, ein alter Freund von mir, wir sehen uns einmal im Jahr, und was ist? Die Enkel sind wichtig, ich nicht. Wir sind alle stolz auf unsere Kinder, die meisten studieren, meine Tochter wandert demnächst in die USA aus, sie ist ein freier Mensch, nicht wahr? Ich sage ihr: Geh! Du musst was versuchen. Ich besuche dich. Wenn du willst, dann geh. Wie kann ich sie aufhalten? Wir sind stolz auf unsere Kinder, aber irgendwie haben wir was verpasst. Die Kinder sind in der Schule, die Eltern arbeiten, keine Zeit. Man muss vielleicht viel mehr zusammen reisen, auch in den Iran reisen, wenn es geht, aber lange das war zu gefährlich. Wir sind in den Ferien nach Frankreich gefahren, das war sehr schön. Verstehst du, was ich meine? Man ist so beschäftigt, um sich ein Leben aufzubauen, und wir haben es geschafft, wir haben uns etwas aufgebaut und dann sind die Kinder plötzlich groß. Sie verstehen, dass man es für sie getan hat, sie nehmen es einem nicht übel, sie lieben einen, aber trotzdem. Ich denke wieder mehr an Teheran. Das ist nicht dieselbe Stadt, nicht dasselbe Land, das Land, aus dem wir weggegangen sind, gibt es nicht mehr, nur in der Erinnerung. Und meine Tochter will in die USA. Andere Richtung sozusagen. Ramin?
Ramin: Ja?
M.: Bist du fertig, Opa?
Ramin: Sie wollen wissen, wann ich zurückkomme. Sie vermissen mich.
M.: Wenn meine Enkel in den USA wohnen, dann ziehe ich dahin.
14 Essen und Reden
Abdullahi: Wir fahren jede Woche nach Kiel. Da treffen sich Leute aus Somalia. Es gibt auch einen Laden mit somalischen Essen. Vor Corona haben wir gekocht und alle zusammen gegessen. Jetzt nicht. Jetzt nur Tee und sitzen mit Maske. Reden.
Abbas: Das ist gut.
Abdullahi: Früher war es besser. Die Leute haben mehr gelacht. Jetzt weniger. Es ist anders.
Abbas: Backgammon.
Abdullahi: Abbas mag Backgammon. Er hilft mir die Sachen nachhause zu tragen, das Essen.
Abbas: So viel Essen.
Abdullahi: Ich kann nicht alles allein tragen. Ich kaufe ein und dann koche ich, hier. Wenn essen, dann reden.
Abbas: Er kocht gut.
Abdullahi: Hier sitzen ohne Maske, essen alle zusammen. Ich koche Somali.
Said: Das heißt: Ich koche somalisch. Und: Ich spreche Somali.
Abdullahi: Du bist gut in der Schule.
Alle lachen.
Gerrit: Du kochst Somali, weil das deine Art ist zu reden. Den anderen zu sagen, dass du sie magst.
Said: Abdullahi kocht sehr gut. Und wir reden gut, alle zusammen.
Gerrit: Du kochst für alle, die hier im Hotel wohnen?
Abbas: Ganzes Geld – kochen.
Gerrit: Vielleicht kannst du uns das beibringen? Wie man somalisch kocht? In einem Kochkurs.
Said: Und dann Somali reden. Oder Arabisch.
Gerrit: Das ist schwer.
Said: Nein, nicht schwer, das ist einfach. Einfach reden. Das ist Sprachpraxis.
Lachen
Abdullahi: Das ist Esspraxis.
Gefördert durch:

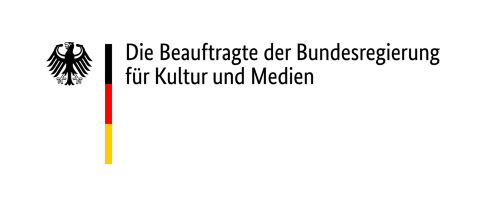



Kontakt
Kunstschlepper e. V.
Birkenweg 16
24242 Felde
Impressum & Datenschutz | Cookie Richtlinien (EU) | Made by thinkcats